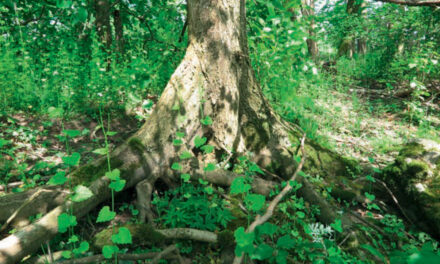Am 05.02.25 fand im Naturparkzentrum Zaberfeld eine inspirierende Vortragsveranstaltung statt, die sich dem spannenden Thema “Biogas aus Wildpflanzen” widmete. Gemeinsam mit dem Landschaftserhaltungsverband Ludwigsburg, der Unteren Landwirtschaftsbehörde am Landratsamt Ludwigsburg und den Biomusterregionen Heilbronner Land und Ludwigsburg-Stuttgart hatte der Naturpark Stromberg-Heuchelberg zu dieser Veranstaltung eingeladen. Die Geschäftsführer des Naturparks Stromberg-Heuchelberg sowie des Landschaftserhaltungsverbandes Ludwigsburg, Dietmar Gretter und Andreas Fallert, konnten mehr als 50 Akteure aus der Naturparkregion, insbesondere zahlreiche Landwirte, begrüßen.
Als Referenten waren unter anderem die beiden Landwirte Werner Kuhn aus dem fränkischen Günthersleben und Markus Frick aus Kißlegg im Allgäu ins Naturparkzentrum gekommen. Beide verfügen über jahrelange Erfahrung im Anbau von Wildpflanzenmischungen für die Biogasgewinnung bzw. den Betrieb einer hofeigenen Biogasanlage. Rund 1 Million Hektar Ackerfläche wurden 2024 deutschlandweit für die Biogasgewinnung genutzt. Mit Abstand am häufigsten kommt dabei Mais zum Einsatz. Angesichts der Klimaveränderungen mit Dürrejahren einerseits, Starkregenereignissen mit Erosion und Überschwemmungen andererseits steht der Maisanbau vor großen Herausforderungen. Der erforderliche Einsatz von Pflanzenschutzmitteln und die vieldiskutierte Biodiversitätskrise sind weitere Diskussionspunkte. Werner Kuhn und Markus Frick konnten auf Basis ihrer Erfahrungen aufzeigen, dass die Wildpflanzen durchaus eine heute schon eine praxistaugliche Alternative darstellen können. Dabei können sie gleich mehrere Vorteile in die Waagschale werfen. Die Mengenerträge reichen nicht ganz an die Erträge im Maisanbau heran, erreichen aber je nach Boden trotzdem rund 70 – 80 % der Mengenerträge mit Mais.
Auf der Habenseite steht der erheblich niedrigere Aufwand für Einsaat und Pflanzenschutz. Gleichzeitig sorgt die mehrjährige Begrünung mit Wildpflanzen für eine hervorragende, humusreiche Bodenstruktur mit deutlich geringerer Erosionsanfälligkeit und höherer Wasserhaltefähigkeit. Will man Überschwemmungen nach Starkregen wie jüngst im Saalbachtal reduzieren, kann das Wasserhaltevermögen humusreicher Böden eine maßgebliche Rolle spielen. Auch die biologische Vielfalt profitiert vom Wildpflanzenanbau. Trotz der aus Ertragsgründen erforderlichen Düngung zeigen sowohl wissenschaftliche Studien als auch die Erfahrungen der Praxis den um ein Mehrfaches höheren Bestand an Bodenlebewesen und an Insekten, ob Wildbienen, Schmetterlinge oder Heuschrecken. Diese bilden wiederum eine wichtige Nahrungsgrundlage für die Vogelwelt, insbesondere feldtypische Boden- und Heckenbrüter, vom Rebhuhn bis zum Sumpfrohrsänger. Das begeistert durchaus auch die Landwirte, wie Markus Frick in schönstem Allgäuer Dialekt vermitteln konnte: „Wenn du in die Bestände neikommsch, do kannsch nur dei Gosch halda und zugugge, so isch do a Leba drin“.
Auch Säugetiere, vom Feldhasen bis zum Wiesel, profitieren von den zusätzlichen Lebensraumstrukturen und dem Nahrungsangebot der mehrjährigen Wildpflanzenbestände. In Zeiten gesellschaftlicher Polarisierung immer wichtiger ist auch die hohe Akzeptanz, die die bunt blühenden Wildpflanzenflächen bei der Bevölkerung genießen. Sie bereichern nicht nur die Landschaft, sondern vermeiden gerade an den Ortsrändern durch die Extensivierung der Bewirtschaftung mit weniger staubreichen Bearbeitungsgängen und dem Verzicht auf Pflanzenschutzmittel viele Konflikte zwischen landwirtschaftlichen Erzeugern und Bevölkerung, sorgten im Gegenteil oft für willkommene Anlässe zum freundlichen Austausch ohne gegenseitige Vorwürfe.
Auch der Wildpflanzenanbau bzw. die daran angeschlossene Biogasgewinnung funktionieren in der Praxis nicht ohne die lenkende Hand des Bewirtschafters. Werner Kuhn und Markus Frick konnten den interessierten Zuhörern jede Menge Tipps zur Bestandsführung, zur Erntetechnik oder zur Düngung mitgeben. Damit „Biogas aus Wildpflanzen“ funktioniert, müssen jedoch neben der Anbau- und Erntetechnik weitere Aspekte beachtet werden. Alicia Läpple, Biodiversitätsberaterin im Fachbereich Landwirtschaft am Landratsamt Ludwigsburg, zeigte die Möglichkeiten und Voraussetzungen einer finanziellen Förderung im Rahmen des baden-württembergischen FAKT-Programmes auf. Vom Erntezeitpunkt bis zur Festlegung einer Winterruhe sind vielfältige Auflagen und Regelungen zu beachten. Aus seinen Erfahrungen konnte Werner Kuhn weitere Anregungen zur finanziellen Ertragssteigerung aufzeigen, von der Anrechnung der Flächen als naturschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahme („Ökopunkte“) bis zu freiwilligen Zuschüssen von Kommunen, Stiftungen oder Jagdpächtern, die in ihrem Revier die Lebensbedingungen für das Niederwild verbessern möchten.
Entscheidend für den Erfolg ist insbesondere eine konstruktive Zusammenarbeit zwischen den Landwirten und den Betreibern der Biogasanlagen in der jeweiligen Region. Die beim Betrieb einer Biogasanlage eingesetzten Mikroben zeigten sich durchaus wählerisch bei der Nutzung ihrer bevorzugten Futterpflanzen, wie Markus Frick berichten konnte. Bei Beachtung einiger Rahmenbedingungen sei die Verwendung von Wildpflanzen aber problemlos möglich, zeige sogar positive Auswirkungen auf den Gasertrag der Anlagen.
Noch lange nach dem offiziellen Programm standen die Teilnehmenden des Vortragsabends im Naturparkzentrum zu angeregten Gesprächen zusammen, verschiedene Landwirte unter den Gästen zeigten sich konkret interessiert an dieser Anbaualternative für ihren Betrieb. Sowohl Experte Werner Kuhn als auch die Vertreter der Veranstalter boten gerne an, offene Fragen interessierter Akteure auch im Nachgang des Vortragsabends zu beantworten – ganz im Sinne des Netzwerkgedankens, der mit den vielfältigen Vortragsabenden am Naturparkzentrum gestärkt werden soll.

 ZIELE & POI´s
ZIELE & POI´s EVENTS & WORKSHOPS
EVENTS & WORKSHOPS Equipment & Ausrüstung
Equipment & Ausrüstung Naturräume & Regionen
Naturräume & Regionen